(Struffelt bei Aachen, Nordrhein-Westfalen)


 Die
Sicherung der Trinkwasserversorgung ist ein zentrales Anliegen der
Menschen.
Aus diesem Grund sind in Deutschland vor allem in den Mittelgebirgen
Talsperren
angelegt worden. Eine solche ist die Dreilägerbach-Talsperre am
nördlichen
Rand der Eifel bei Aachen. Die Belastung der Wasserqualität mit
Schwebstoffen
und Kolibakterien im Herbst 1993 hat dazugeführt, dass mehrere
Gutachten
beauftragt wurden, um die Ursachen hierfür zu ermitteln.
Zur Beseitigung der Probleme wurde darauf
aufbauend ein umfangreicher
Maßnahmenkatalog
entwickelt, der im Wesentlichen Gegenstand der Beurteilung im
Rahmen
der Diplomarbeit ist. Gleichzeitig fließen einige
weitere
Maßnahmen in die Beurteilung ein, die im Untersuchungsgebiet von
Seiten des Naturschutzes geplant worden sind.
Die
Sicherung der Trinkwasserversorgung ist ein zentrales Anliegen der
Menschen.
Aus diesem Grund sind in Deutschland vor allem in den Mittelgebirgen
Talsperren
angelegt worden. Eine solche ist die Dreilägerbach-Talsperre am
nördlichen
Rand der Eifel bei Aachen. Die Belastung der Wasserqualität mit
Schwebstoffen
und Kolibakterien im Herbst 1993 hat dazugeführt, dass mehrere
Gutachten
beauftragt wurden, um die Ursachen hierfür zu ermitteln.
Zur Beseitigung der Probleme wurde darauf
aufbauend ein umfangreicher
Maßnahmenkatalog
entwickelt, der im Wesentlichen Gegenstand der Beurteilung im
Rahmen
der Diplomarbeit ist. Gleichzeitig fließen einige
weitere
Maßnahmen in die Beurteilung ein, die im Untersuchungsgebiet von
Seiten des Naturschutzes geplant worden sind. Um eine adäquate Einschätzung der verschiedenen Maßnahmen und ihrere jeweiligen Umsetzung vornehmen zu können, erfolgt neben einer Aufarbeitung der naturräumlichen Gegegebenheiten, d.h. Klima, Geologie, Boden und Vegetation, der historischen Entwicklung und der vorhandenen Nutzung eine detaillierte Aufnahme des aktuellen Zustands des Untersuchungsgebietes. Zur konkreten Beurteilung der Maßnahmen unter ingenieurbiologischen und naturschutzfachlichen Gesichtspunkten werden zunächst die allgemeinen Ziele der Ingenieurbiologie und des Naturschutzes herangezogen. Nachdem diese soweit als möglich auf die gegebene Problemstellung hin konkretisiert worden sind, wird überprüft, inwieweit die einzelnen Maßnahmen diese Ziele erfüllen.
In der Beurteilung erweisen sich die Maßnahmen hinsichtlich der Planung unter beiden Beurteilungsaspekten als weitgehend zielkonform. In der Ausführung kommt es aufgrund von Umsetzungsdefiziten beszüglich der Quantität sowie der Qualität zu einer weniger weitreichenden Zielerfüllung als auch zu größeren Unterschieden zwischen den beiden Beurteilungsaspekten. Diese Unterschiede sind auch in der Wirkung deutlich wiederzuerkennen, da bereits an einigen, neu ausgebauten Uferabschnitten Erosionsansätze zu verzeichnen sind. So ist der Ansatz der Planung, der das gesamte Gewässersystem als Einheit voraussetzt, in der Ausführung und somit auch in den Auswirkungen nicht entsprechend berücksichtigt.
Wenngleich
auch verschiedentlich Synergieeffekte zu verzeichnen sind, so gibt es
doch
auch Bereiche, in denen die Ziele nicht gerade entgegengesetzt, aber
doch
nicht in die gleiche Richtung laufen. Diese ergeben sich in erster
Linie
aufgrund der Erfordernisse des speziellen Arten- und Biotopschutzes,
der
mitunter Ziele definiert, die von der allgemeinen Zielsetzung der
Naturnähe,
mit welcher die Ziele der Ingenieurbiologie weitgehend konform sind,
abweichen.
Aufbauend
auf den Ergebnissen der Beurteilung werden abschließend
Maßnahmen
für die weitere Entwicklung des Gebietes formuliert. Dabei finden
sowohl die Erfordernisse des ingenieurbiologischen
Gewässerschutzes
als auch diejenigen der Biotopentwicklun von Seiten des Naturschutzes
Berücksichtigung.
Wie die Beurteilung der Sanierungsmaßnahmen ergeben hat,
weisen
beide Ansätze weitreichende Parallelen auf.
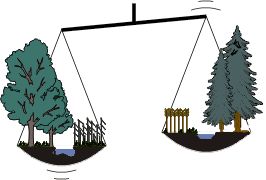 Der
Olmsbach verläuft südöstlich der Ortschaft Suderburg, wo
er nach dem Zusammenfluss seiner drei Quellbäche die Hoflage
Olmsruh
passiert und kurz darauf in die Hardau mündet. Als
Renaturierungsobjekt
wurde der kleine Heidebach aufgrund der Tatsache thematisiert, dass er
mit seinem oberirdischen Einzugsgebiet weitgehend im Gebiet des
Flurbereinigungsverfahrens
Räber liegt. Dies beinhaltet die Möglichkeit im Zuge von
Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen die Renaturierung des Olmsbaches zu
betreiben.
Im Rahmen einer eingehenden Kartierung des Gewässerlaufes sind
einige
gravierende Beeinträchtigungen festgestellt worden, die aus dem
Bachlauf
streckenweise ein relativ naturfernes Gerinne gemacht haben. Neben den
üblichen Durchlassbauwerken und Befestigungsmaßnahmen im
Ufer-
und Sohlbereich ist in diesem Zusammenhang insbesondere auf eine
Vielzahl
an Fischteichen im Haupt- und Nebenschluss hinzuweisen.
Der
Olmsbach verläuft südöstlich der Ortschaft Suderburg, wo
er nach dem Zusammenfluss seiner drei Quellbäche die Hoflage
Olmsruh
passiert und kurz darauf in die Hardau mündet. Als
Renaturierungsobjekt
wurde der kleine Heidebach aufgrund der Tatsache thematisiert, dass er
mit seinem oberirdischen Einzugsgebiet weitgehend im Gebiet des
Flurbereinigungsverfahrens
Räber liegt. Dies beinhaltet die Möglichkeit im Zuge von
Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen die Renaturierung des Olmsbaches zu
betreiben.
Im Rahmen einer eingehenden Kartierung des Gewässerlaufes sind
einige
gravierende Beeinträchtigungen festgestellt worden, die aus dem
Bachlauf
streckenweise ein relativ naturfernes Gerinne gemacht haben. Neben den
üblichen Durchlassbauwerken und Befestigungsmaßnahmen im
Ufer-
und Sohlbereich ist in diesem Zusammenhang insbesondere auf eine
Vielzahl
an Fischteichen im Haupt- und Nebenschluss hinzuweisen.
 Etwa
seit Mitte des 18. Jahrhunderts sind im Zuge der Aufhebung und
Schleifung
ehemaliger Festungsanlagen nicht mehr nur die Siedlungen und
Städte
erweitert sondern auch unterschiedliche Grünflächen angelegt
worden. Diese sogenannten Wallgrünflächen lassen sich
hinsichtlich
ihrer Gestaltung in drei Kategorien einteilen: landschaftliche
Parkanlage
(ca. 1750 bis 1850), Ringstraße (ca. 1850 bis 1900) und
weitläufige,
der Volksparkidee nahestehende Grünsysteme (ca. 1900 bis 1920).
Soweit
die Wallgrünflächen erhalten geblieben sind, übernehmen
sie noch heute wichtige Funktionen im städtebaulichen Kontext. Sie
gliedern und erschließen die angrenzenden Stadtteile, sind
lebendiges
Zeugnis der Stadtgeschichte, dienen aufgrund ihrer linearen Strukturen
als vernetzender Lebensraum für Tiere und Pflanzen und bieten
nicht
zuletzt vielfältige Naherholungsmöglichkeiten für die
Einwohner
der Stadt.
Etwa
seit Mitte des 18. Jahrhunderts sind im Zuge der Aufhebung und
Schleifung
ehemaliger Festungsanlagen nicht mehr nur die Siedlungen und
Städte
erweitert sondern auch unterschiedliche Grünflächen angelegt
worden. Diese sogenannten Wallgrünflächen lassen sich
hinsichtlich
ihrer Gestaltung in drei Kategorien einteilen: landschaftliche
Parkanlage
(ca. 1750 bis 1850), Ringstraße (ca. 1850 bis 1900) und
weitläufige,
der Volksparkidee nahestehende Grünsysteme (ca. 1900 bis 1920).
Soweit
die Wallgrünflächen erhalten geblieben sind, übernehmen
sie noch heute wichtige Funktionen im städtebaulichen Kontext. Sie
gliedern und erschließen die angrenzenden Stadtteile, sind
lebendiges
Zeugnis der Stadtgeschichte, dienen aufgrund ihrer linearen Strukturen
als vernetzender Lebensraum für Tiere und Pflanzen und bieten
nicht
zuletzt vielfältige Naherholungsmöglichkeiten für die
Einwohner
der Stadt.